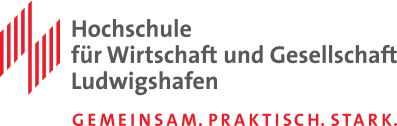Beim diesjährigen PRIO1 – Das Klima-Netzwerk Klimapreis in Mannheim stand eine Frage im Zentrum, die auch das Profil des Competence Center for Leadership Experience (CCLE) prägt:
Wie kann Künstliche Intelligenz (KI) dazu beitragen, Klimaschutz und nachhaltige Führung wirksam zu gestalten – und was muss dafür auf der Ebene von Verhalten, Organisation und Verantwortung passieren?
Prof. Dr. Burkhard Schmidt vertrat das CCLE auf einem hochkarätig besetzten Panel mit
- Karen Paul, IT-Leitung bei Greenpeace,
- Nike Klaubert, SAP,
moderiert und eingebettet in das starke Netzwerk von PRIO1 – Das Klima-Netzwerk.
Im Folgenden fassen wir die zentralen Erkenntnisse zusammen – und zeigen, was sie konkret für unsere Studierenden und Praxispartner bedeuten.
1. KI allein löst kein Klimaproblem – Verhalten ist der Engpass
Die Diskussion machte sehr deutlich:
Klimaschutz ist längst kein Wissensproblem mehr, sondern ein Umsetzungs- und Verhaltensproblem.
Aus Sicht der Wirtschafts- und Klimapsychologie bedeutet das:
- Menschen entscheiden nicht nur rational, sondern unter dem Einfluss von Emotionen, Routinen, sozialen Normen und Anreizsystemen.
- Technologische Lösungen – auch KI – entfalten ihre Wirkung erst dann, wenn sie diese Realität berücksichtigen.
- Ob KI am Ende Emissionen reduziert oder nur bestehende Muster effizienter macht, hängt davon ab, in welche Ziele, Strukturen und Entscheidungsarchitekturen sie eingebettet wird.
Damit verschiebt sich der Fokus: Weg von der Frage „Was kann KI technisch?“, hin zu „Wie gestalten wir Kontexte, in denen KI nachhaltiges Verhalten wahrscheinlicher macht?“.
2. Drei psychologische Kernperspektiven des CCLE
Im Panel wurden drei Perspektiven besonders deutlich, die auch das Selbstverständnis des CCLE prägen.
a) Entscheidungsarchitekturen statt Technikfolklore
Psychologische und verhaltensökonomische Forschung zeigt, dass kleine Veränderungen der Entscheidungsumgebung große Effekte haben können:
- Defaults: Voreinstellungen (z. B. nachhaltige Lieferoptionen, Bahn statt Flug als Standard) beeinflussen Verhalten stark.
- Soziale Normen: Informationen darüber, wie andere handeln, setzen Anker („Best-in-Class“-Benchmarks, Teamvergleiche).
- Feedback & Gamification: Rückmeldungen zu CO₂-Fußabdruck, Fortschrittsanzeigen und spielerische Elemente fördern Engagement.
KI kann genau hier ansetzen – indem sie solche Strukturen dynamisch und personalisiert gestaltet. Die Frage ist weniger, ob KI etwas tut, sondern wie wir diese Gestaltung wissenschaftlich fundiert vornehmen.
b) Psychologischer Umgang mit KI: Vertrauen kalibrieren
Ein zweiter Schwerpunkt des Panels war der psychologisch kluge Umgang mit KI:
- Menschen schwanken zwischen naiver Technikbegeisterung („Die KI wird das schon richtig machen“) und pauschaler Ablehnung („Davon will ich nichts wissen“).
- Hinzu kommen kognitive Verzerrungen wie der „Automation Bias“: Wenn ein System ein Ergebnis ausgibt, neigen wir dazu, es weniger kritisch zu hinterfragen.
- Aus Sicht der Psychologie geht es darum, Vertrauen zu kalibrieren:
- Transparenz darüber, welche Ziele optimiert werden,
- verständliche Erklärungen (Explainable AI),
- echte Eingriffsmöglichkeiten und Verantwortung auf menschlicher Seite.
KI soll im organisationalen Alltag ein Werkzeug sein – kein Ersatz für professionelles Urteil und Führung.
c) Ethik, Bias und Greenwashing
Der dritte Schwerpunkt war die Frage, wie wir Bias, Fairness und Greenwashing im KI-Kontext adressieren:
- Verzerrte Trainingsdaten, einseitige Zielgrößen oder homogene Entwicklungsteams können dazu führen, dass KI bestehende Ungleichheiten skaliert.
- Nachhaltigkeitsratings oder Klimascorings, die von KI unterstützt werden, können – falsch gestaltet – zu Greenwashing beitragen, statt Transparenz zu schaffen.
- Notwendig sind daher:
- klar dokumentierte Zielgrößen („Was optimiert dieses System eigentlich – und für wen?“),
- unabhängige Audits,
- interdisziplinäre Governance-Strukturen, in denen Technik, Ethik, Psychologie und Praxis gemeinsam arbeiten.
3. Was bedeutet das für unsere Studierenden?
Für die Studierenden der Wirtschaftspsychologie und verwandter Studiengänge an der HWG Ludwigshafen eröffnet dieses Themenfeld ein breites Lern- und Anwendungsfeld:
- Kompetenzaufbau in „AI Literacy“ und Klimapsychologie
- Verstehen, wie KI-Systeme grundlegend funktionieren – und wo ihre psychologischen Implikationen liegen.
- Einordnen, wie Emotionen, Normen und Entscheidungsarchitekturen nachhaltiges Verhalten beeinflussen.
- Praxisprojekte und Fallstudien
- Analyse realer KI-Anwendungen im Nachhaltigkeitskontext: Wo unterstützen sie sinnvolle Verhaltensänderungen, wo verstärken sie Rebound-Effekte oder Greenwashing?
- Entwicklung eigener Konzeptideen für „human-centered“ KI-Lösungen in Unternehmen.
- Abschlussarbeiten und Forschungsprojekte
- Empirische Arbeiten zu Themen wie „Vertrauen in KI“, „Akzeptanz von KI-basierten Nachhaltigkeitsinstrumenten“, „Bias-Wahrnehmung in KI-Anwendungen“ oder „psychologische Wirkmechanismen digitaler Klimainterventionen“.
- Kooperationen mit Praxispartnern, bei denen Studierende systematisch Daten erheben, Interventionen konzipieren und evaluieren.
Das CCLE versteht sich hier als Brücke: zwischen wissenschaftlicher Evidenz, didaktisch guten Lehrformaten und realen Anwendungsfeldern in Unternehmen und Organisationen.
4. Was bedeutet das für unsere Praxispartner?
Für Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen, die mit KI und Nachhaltigkeit arbeiten (oder dies planen), ergeben sich aus der Arbeit des CCLE mehrere konkrete Kooperationsansätze:
- Analyse bestehender KI- und Nachhaltigkeitsanwendungen
- Verhaltenspsychologische Bewertung: Unterstützt das System tatsächlich nachhaltige Entscheidungen – oder optimiert es nur bestehende Routinen?
- Analyse möglicher Bias-Risiken, Greenwashing-Gefahren und Akzeptanzhürden.
- Co-Design neuer Lösungen
- Entwicklung von Prototypen für KI-gestützte Entscheidungsunterstützung im Einkauf, im Nachhaltigkeitsmanagement oder in der Personal- und Führungsarbeit.
- Gestaltung von Entscheidungsarchitekturen und Feedbacksystemen, die auf wissenschaftlich gesicherten Mechanismen beruhen.
- Leadership- und Qualifizierungsformate
- Workshops und Programme für Führungskräfte zu „AI, Leadership & Climate Action“:
- Wie lese ich KI-gestützte Reports richtig?
- Wie behalte ich Verantwortung und Urteilsfähigkeit?
- Wie verankere ich Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Zielsystemen und Anreizstrukturen?
- Begleitung von Change-Prozessen, in denen neue digitale Instrumente eingeführt werden.
- Workshops und Programme für Führungskräfte zu „AI, Leadership & Climate Action“:
- Forschungs- und Pilotprojekte
- Gemeinsame Projekte, in denen KI-basierte Nachhaltigkeitstools in der Praxis erprobt und wissenschaftlich begleitet werden.
- Einbindung von Studierenden über Projekt- und Abschlussarbeiten, um frühzeitig neue Perspektiven und Analysen in die Organisation zu bringen.
5. Fazit: Auftrag für das CCLE
Das Panel beim PRIO1-Klimapreis hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig es ist, Führung, KI und Nachhaltigkeit zusammen zu denken – und dabei die psychologische Dimension zentral mitzudenken.
Für das CompetenceCenter for Leadership Experience (CCLE) an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen bedeutet das:
- Wir verbinden wissenschaftliche Evidenz aus Wirtschaftspsychologie, Klimapsychologie und Führungsforschung
- mit konkreten Anwendungen in Lehre, Praxisprojekten und Kooperationen,
- um eine Führungskultur zu fördern, die verantwortungsvoll, evidenzbasiert und zukunftsorientiert mit KI und Nachhaltigkeit arbeitet.
Wenn Sie als Studierende, Lehrende oder Praxispartner Interesse an einem vertieften Austausch, an gemeinsamen Projekten oder an Formaten rund um „AI, Leadership & Climate Action“ haben, freut sich das CCLE-Team über Ihre Kontaktaufnahme.
Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass KI nicht nur technologisch beeindruckt – sondern zu einem realen Hebel für nachhaltige Veränderung in Organisationen wird.